
Brodbeck macht Schluss
Hier der Originalbericht aus der AZ:
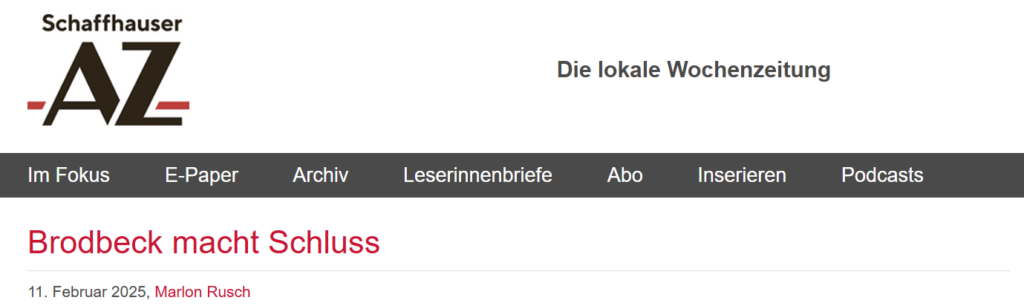
11. Februar 2025, Marlon Rusch

Foto: Robin Kohler
Eduard Brodbeck hat das Sturmgewehr 90 entwickelt, eine der berühmtesten Waffen der Welt. Der Ingenieur ist ein Sinnbild für die prosperierende und moralisch flexible Nachkriegsschweiz. Jetzt muss er sein Erbe loslassen.
«Strebe in allem, was du tust, nach Perfektion. Beginne mit dem Besten, das es gibt, und verbessere es. Wenn es noch nicht existiert, erfinde es. Akzeptiere nichts, das fast richtig oder beinahe gut genug ist.» –
Sir Frederick Henry Royce
Betritt man das SIG-Waffenmuseum in Neuhausen, wird man kritisch beäugt von Henri Guisan. Der Weltkriegsgeneral, der hier als Porträt an der Wand hängt, hat dem Land in den Vierzigerjahren den Réduit-Gedanken eingepflanzt. In geneigten Kreisen steht er bis heute für die Wehrhaftigkeit und Unabhängigkeit der Schweiz.
Der Pensionär, der unter Guisans gestrengen Augen die Besucher empfängt, um sie durch sein Museum zu führen, ist zwar weniger bekannt als der General. Doch im Grunde steht er für dasselbe. Eduard Brodbeck hat für die SIG das Sturmgewehr 90 entwickelt, das Prunkstück der Schweizer Waffenproduktion, Exportschlager, Chiffre für Präzisionsarbeit und bewaffnete Neutralität.
Brodbeck hat sein Leben der SIG verschrieben. 1947 trat er als Lehrling in die Firma ein, 1996 ging er als Vizedirektor in Rente. 2007 gründete er mit einer Handvoll Frauen und Männern die Stiftung Historische Waffensammlung, um das Wissen, das Erbe und das Andenken an 150 Jahre Waffenentwicklung in Neuhausen zu bewahren.
Edi Brodbeck war die Personifizierung der prosperierenden Nachkriegsschweiz. Heute aber ist er 94 Jahre alt; die Waffensparte der SIG wurde längst ins Ausland verkauft; bald gehen die Stiftung und das Museum in neue Hände über. Es ist Zeit loszulassen.
Als Brodbeck 1931 zur Welt kam, bewirtschafteten seine Eltern einen Bauernhof in Buchthalen. Zu Hause stand ein Flobert-Gewehr herum, das man zwar «Gartenflinte» nannte, dem Buben aber dennoch Eindruck machte. Während des Weltkriegs fuhr er manchmal mit dem Velo zum Windegg, um das wassergekühlte Maschinengewehr Mg 11 zu bestaunen, mit dem im Ernstfall auf deutsche Bomber geschossen worden wäre. Die Faszination für Technik, die er damals entwickelte, sollte eine steile Karriere antreiben.
In der Rekrutenschule ging Brodbeck zu den Mitrailleuren und trug ebensolche wassergekühlte Mg 11 mit sich herum, bis ihm fast der Arm abfiel. Vor allem aber begann er eine Lehre als Maschinenzeichner bei der SIG. Dort half er bald am Morgen vor und am Abend nach seiner eigentlichen Arbeit nebenan in der Waffenabteilung mit. Auch die Ferien verbrachte der Teenager dort am Zeichentisch. «Eigentlich hatte ich zwei Jobs», sagt Brodbeck heute. Als ihm und seinen Erfolgen bei der SIG Jahrzehnte später ein Buch gewidmet wurde, stand dort über Brodbeck: «Disziplin und der Wille zur Pflichterfüllung sind zweifellos Bausteine seines Erfolgs.»
Nach der Lehre studierte er am Technikum Ingenieurwesen und wechselte dann zur Waffenfabrik Bührle in Oerlikon. Doch 1957 holte ihn die SIG als Gruppenchef an den Neuhauser Zeichentisch zurück. Die vereinigte Bundesversammlung hatte dem Konzern den Zuschlag für ein Prestigeprojekt gegeben: ein neues Gewehr für die Schweizer Armee. Mit dem Sturmgewehr 57 wurde der Ingenieur Edi Brodbeck gross.
Im SIG-Waffenmuseum lagern heute nicht nur rund 700 Schusswaffen, die eine 150-jährige technische Entwicklung dokumentieren. Nach der Begrüssung öffnet Edi Brodbeck unter den Augen von General Guisan zuerst einmal ein schweres Kassenbuch von 1855 und zeigt, dass die SIG schon damals eine vorbildliche Arbeitgeberin gewesen sei und eine betriebseigene Versicherung eingeführt hatte, viele Jahrzehnte vor den staatlichen Versicherungen. Wie Brodbeck durch sein Waffenmuseum führt, ist er nicht nur Hüter eines technologischen Erbes. Er macht auch PR für eine Firma, die es so nicht mehr gibt.
Seit 1860 baute die SIG Schusswaffen. Der Bundesrat entschied damals, für die Armee des neu gegründeten Bundesstaats eine einheitliche Bewaffnung anzuschaffen, nachdem die Kantone bis anhin ihre Regimenter bei lokalen Büchsenmachern ausgestattet hatten. Also baute man in Neuhausen fortan Vetterli-Gewehre. «Gewehre waren damals Kunstwerke», sagt Brodbeck.
Der pensionierte Ingenieur führt normalerweise Menschen durch sein Museum, die bereits einiges über Schusswaffen wissen. Er kann stundenlang mit Zahlen und Abkürzungen jonglieren, von Gasdruckladern, Kunststoffscharnieren und Rollenverschlüssen schwärmen und die Funktionsweise der verschiedenen Gewehrlaufräumwerkzeuge und Laufziehmaschinen erklären. Doch man merkt auch, dass Brodbeck bei der SIG Karriere machte, durch die Lande jettete und eine Ahnung davon bekam, welche Wechselbeziehungen zwischen der Weltpolitik und der Schweizer Waffenindustrie herrschten.
Zudem ist er ein lakonischer Erzähler. Im Buch über Brodbeck und seine Entwicklungen steht, seine Leidenschaft verberge sich «hinter grösstmöglicher Sachlichkeit». Fragt man ihn, wie es sich anfühle, mit einem Vetterli-Gewehr zu schiessen, sagt er: «Man hat einen Haufen Dampf vor dem Kopf».

Nach dem zweistündigen Rundgang durch die vier kleinen Räume dampft der Kopf gleich selbst. Doch man hat auch ein Gefühl für einen Konzern bekommen, der über Jahrzehnte passgenau das in eine Maschine goss, wonach sich die Schweizer Sicherheitspolitik des 20. Jahrhunderts sehnte.
Die Hauptkundin der SIG-Waffensparte war stets die Schweizer Armee. Doch die Aufträge kamen zyklisch herein, mal gab es nichts zu tun, dann wieder viel zu viel. Als die SIG 1957 Edi Brodbeck zurückholte, war Feuer im Dach. In Ungarn gab es einen Volksaufstand gegen die Kommunisten; der ägyptische Präsident Nasser verstaatlichte den Suezkanal, worauf der Westen militärisch eingriff; der Kalte Krieg war in vollem Gang. Doch während andere Armeen schon fünfzehn Jahre zuvor mit vollautomatischen Gewehren gekämpft hatten, schossen die Schweizer Soldaten noch immer mit dem Karabiner 31, einem Repetiergewehr.
Die SIG bekam den Auftrag, ein erstklassiges Sturmgewehr zu entwickelt, und hatte dafür gerade einmal drei Jahre Zeit. Die perfekte Aufgabe für einen jungen Ingenieur wie Edi Brodbeck, sich zu beweisen. Die SIG fuhr einen stattlichen Betrieb hoch, spannte eng mit der Industrie und den Bestellern aus der Armee zusammen und baute ein Netz mit 200 Zulieferern auf. «In den drei Jahren haben wir manchen Husarenritt gemacht», sagt Brodbeck.
Im Rückblick sei vor allem die Entwicklung des übersetzten Masseverschlusses ausschlaggebend gewesen, der die Energie des Rückstosses auf die Schulter des Soldaten um einen Drittel reduziert habe. So konnte das Sturmgewehr als multifunktionale Waffe konzipiert werden, ein Vollautomat mit Seriefeuerfunktion, ausserdem konnte es Gewehrgranaten abzufeuern. Wovon Brodbeck erzählt, ist eine Höllenmaschine. Er selber, früher ein exzellenter Schütze, sagt: «Mit dem Sturmgewehr 57 schiessen Sie wie ein Herrgöttli.»
Bald hatte Brodbeck in der SIG einen Ruf. Ging einer seiner Mitarbeitenden mit einer Bitte zum Leiter der Fabrikation, fragte dieser zurück: «Warst du wieder beim Brodbeck? Der spinnt doch.» Die Entwicklung und Fertigung eines Sturmgewehrs ist eine Hochpräzisionsaufgabe, doch Brodbeck wollte immer noch genauer sein. Er sagt: «Mein Steckenpferd war die Minimierung von Störungen.»
Ein technisches Problem zu lösen, so Brodbeck, sei eigentlich simpel: Man müsse immer weiter und weiter suchen und dürfe sich nie entmutigen und vom Weg abbringen lassen. Man müsse aber auch den Punkt erkennen, wo eine Sackgasse tatsächlich eine Sackgasse sei – und dann grundsätzlich einen neuen Weg einschlagen. So gewinne man immer. Im schlimmsten Falle Erfahrung.
Die Entwicklungsabteilung der SIG sei ein unheimlich kreatives Umfeld gewesen, erinnert sich Brodbeck. Und er ein fordernder Chef. Es ging immer auch darum, die Konkurrenz zu übertrumpfen. Hatte ein Kunde ein Problem, liess er alles liegen und stieg ins Flugzeug. Einmal fuhr er in einer Stunde und 50 Minuten von Neuhausen nach Bern – zu einer Zeit, als es noch keine Autobahnen gab.
Ob man die Methode Brodbeck – immer weiter tüfteln, sich nie vom Weg abbringen lassen, aber den Moment erkennen, an dem es einen Wechsel braucht – auch auf andere Lebensbereiche anwenden könne? «Ja», sagt Brodbeck.
Seine Frau lernte er Ende der Vierzigerjahre beim Turnverein Buchthalen kennen, sie leben heute noch zusammen in einer schönen Wohnung mit viel Glas und modernen Möbeln und Bildern in Buchthalen, wo sie sich gegenseitig im Alltag unterstützen. Es hat nie einen Bruch gebraucht. «Sie war die Innenministerin, ich der Aussenminister», sagt Edi Brodbeck liebevoll, doch seine Frau sei auch oft allein gewesen, wenn er sich die Nächte in den SIG-Werkhallen um die Ohren geschlagen habe. Heute noch ist es schwierig, einen Termin mit Edi Brodbeck zu vereinbaren, sein Kalender ist proppenvoll. Der Ingenieur läuft auch im fortgeschrittenen Alter wie eines seiner Gewehre: präzise, gut geschmiert, störungsunanfällig.
Manchmal habe seine Frau zu ihm gesagt: Man darf ja niemandem sagen, wo du arbeitest. Denn ein Dilemma lag ja auf der Hand: Ihr Mann baute Maschinen, die den Zweck hatten, Menschen zu töten. Eine von Edi Brodbecks Devisen lautet zwar: «Ein Schweizer Soldat muss an der Grenze sein Land schützen. Dafür ist nur die beste Waffe gut genug.» Doch die SIG produzierte nicht nur für die Schweizer Armee. Schon 1930 lieferte man Gewehre nach China an Maos Gegenspieler Chiang Kai-shek. Ein Bild im Museum zeigt eine Gruppe Militärstudenten aus Abessinien, dem heutigen Äthiopien, 1934 in einem Schweizer Schiessstand. Vor einigen Jahren berichtete die AZ nach Archivrecherchen in Chile, wie die SIG das Waffenexportverbot umschiffte und auch noch Sturmgewehre nach Chile lieferte, als das eigentlich verboten war (siehe «Gewehre für Pinochet», Ausgabe vom 15. April 2021).
Für Edi Brodbeck aber bedeuten diese Waffenlieferungen kein Dilemma. Mit grosser Selbstverständlichkeit sagt er, es spiele ja eigentlich keine Rolle, ob man Gewehre oder Nähmaschinen baue. Wer eine Waffe suche, finde ja so oder so eine. Was Brodbeck als Ingenieur auszeichnete, sein Wille, die Probleme von allen Seiten zu beleuchten und zu durchdringen, fehlt ihm in moralischen Fragen, wo die Welt nicht aus Nullen und Einsen besteht und sich keine Störungsraten reduzieren lassen. Vielleicht ist es auch einfach opportun, sich diesen Fragen nicht stellen zu müssen. Wie hätte er sonst seinen Job machen können?
Daneben gibt es ein ganz praktisches Argument für Waffenexporte: Eine technische Entwicklung dürfe nie eingefroren werden, der Prozess müsse immer in Gang bleiben. Ein Sturmgewehr sei ein Organismus mit tausend Variabeln: Ändert man den Kolben, wackelt der Lauf. «Die permanente Justierung ist das Wichtigste. Ist man drei Monate weg vom Geschäft, hat man den Anschluss verloren.» Eine hochqualitative Waffenfirma wie die SIG hätte gar nicht nur für die Schweizer Armee produzieren können.
Die Technikgeschichte gibt ihm Recht. Mit den Erfahrungen, die mit den 100 000 Gewehren für Südamerika gemacht wurden, gewann die SIG die Ausschreibung für ein neues Sturmgewehr für die Schweizer Armee. «Um eine Ausschreibung zu gewinnen, muss man die Nase im Wind haben», sagt Brodbeck. Was nun folgte, war sein Meisterstück. Mit dem Sturmgewehr 57 wurde er gross; mit dem Sturmgewehr 90, das er als technischer Leiter verantwortete, wurde er alt.
Für das Sturmgewehr 90, an dem die SIG ab 1978 tüftelte und das hunderte Arbeitsplätze in Neuhausen sicherte, verwendete das Team um Brodbeck Kunststoff, um das Gewicht zu reduzieren. Die Anzahl Teile wurde auf 170 reduziert. Handlichkeit, Sicherheit, Präzision, Lebensdauer – alles wurde in der zehnjährigen Entwicklungszeit noch einmal gesteigert. Wieder hat Brodbeck die Störrate mit unerbittlichem Einsatz nach unten getrieben, immer den Schweizer Soldaten vor Augen, der irgendwo an der Grenze steht und dessen Leben davon abhängt, ob sein Gewehr funktioniert oder nicht.
Im Museum zeigen Bilder, wie Testpersonen bei minus 20 Grad im grössten Schlamm mit dem Gewehr hantieren. «Den mitlaufenden Ladegriff, der das Eis im Patronenlager aufbrechen kann, haben wir von Kollege Kalaschnikow übernommen», sagt Brodbeck.
Michail Kalaschnikow, der bekannteste Büchsenmacher der Welt, war 1996 bei der SIG in Neuhausen zu Besuch. Nachdem der frisch pensionierte Brodbeck und der schon lange pensionierte Kalaschnikow zusammen im Schiessstand waren, sagte der Russe zum Schweizer: «Dein Gewehr schiesst besser.» Heute relativiert Brodbeck. Natürlich sei die AK-47 von Kalaschnikow ein «Kugelspritz» und lange nicht so genau wie das Sturmgewehr 90. Aber das sei auch nie die Anforderung gewesen. Die Kalaschnikow müsse vor allem robust sein für Kriegseinsätze. «In der Schweiz war das ausserdienstliche Schiessen immer auch ein Faktor. Auch deshalb setzten wir derart auf Präzision.»
So hat jedes Land sein Gewehr. Und seine Büchsenmacher. Kalaschnikow war General, bekam als Held der sozialistischen Arbeit zwei Stachanow-Orden verliehen, darüber hinaus drei Lenin-Orden und einen Doktortitel an einer technischen Universität. Brodbeck war Wachtmeister und sagt heute, Kalaschnikow sein ein «glattes Mannli» gewesen.
Edi Brodbeck ist ein bescheidener Mann und betont, dass er bei der SIG vor allem exzellente Leute um sich herum gehabt habe. Aber natürlich schwingt auch Wehmut mit, wenn er daran denkt, dass sein Erbe nicht weitergeführt wird. Wegen Exportbeschränkungen und des öffentlichen Drucks auf die Rüstungsindustrie verkaufte die SIG 2000 ihre Waffensparte ins Ausland.
Unterhält man sich mit Brodbeck, erhält man den Eindruck, er trauere dem Kalten Krieg hinterher, als die Welt noch einfacher war und Männer mit Gewehren an der Grenze die Schweizer Neutralität verteidigten.
Der Auftrag für das Sturmgewehr 57 kam damals direkt von der Bundesversammlung. Heute wollten bei Rüstungsgütern alle mitreden: «In Bern wird nur noch nach politischen Grundsätzen entschieden», beklagt sich Brodbeck und wird erstmals laut. Dass die Politik wenig von Technik verstehe, habe man bei der Abstimmung über den Kauf des Kampfjets Gripen gesehen.
Doch Brodbeck ist keineswegs verbittert. Er sagt: «Es ist einfach eine andere Zeit.» Da drückt sie wieder durch, die Nüchternheit des Ingenieurs.





